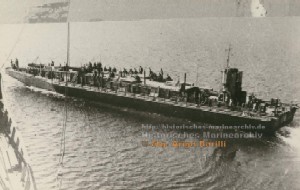Mein Einsatz bei der 13. Landungsflottille
Ein Erlebnisbericht von Karl-Heinz Koppel
Vorbemerkung
Themenbezogene Links
Übersicht Marinefährprähme
(mit Typbeschreibung Typ AM)
Nach einem zweimonatigen Zugführerlehrgang wurden wir Fähnriche, die wir uns seinerzeit auf der Marineschule zur Torpedowaffe gemeldet hatten, zur Torpedoschule II nach Regenwalde in Hinterpommern kommandiert. Nach nur vier Wochen Unterricht evakuierte man jedoch, als die Sowjetarmee immer näher heranrückte, unseren gesamten Lehrgang kurzerhand nach Flensburg-Mürwik, wo er unter weitaus günstigeren Umständen als bislang ordnungsgemäß zu Ende geführt wurde. Mit jedem Tag stieg bei uns die Spannung, was die Marineführung anschließend mit uns, den Angehörigen eines jetzt vollständig ausgebildeten Offiziersjahrgangs, vorhatte. Wohin also würde man uns schicken? An die Ostfront, wo schon zahlreiche Marineeinheiten eingesetzt waren? Auf die wenigen noch vorhandenen Schiffe in Nord- und Ostsee? Oder doch noch zu den Kleinkampfverbänden, zu denen auch ich mich wenige Monate vorher in Stralsund leichtsinnigerweise gemeldet hatte? Die Auflösung dieses Rätsels erfolgte an einem der letzten Lehrgangstage.
Hierzu mußten wir im Flur unseres Unterkunftsgebäudes antreten. Einer unserer Dienstvorgesetzten begann, Namen von Schiffen und Flottillen und die diesen Einheiten zu-gewiesenen Fähnriche vorzulesen. Ich rechnete mir selbst hierbei keine besonderen Chancen aus, ging ich doch davon aus, daß in erster Linie die aktiven Offiziersanwärter Bordkommandos erhielten und wir Reservisten zu irgendeiner Landeinheit gesteckt würden.
Aber dann fiel überraschend mein Name unter Dreien, in meiner Erinnerung ungefähr in folgender Form: „13. Landungsflottille Gotenhafen: die Fähnriche Krebs, Kramer und Koppel!“ Es war eine der letzten vorgelesenen Bordeinheiten, somit war ungefähr die Hälfte der Angetretenen untergebracht, dem großen Rest blieb nur der Landeinsatz. Tiefe Betroffenheit bei den Letzteren und, ich muß es zugeben, eher gedämpfte als ungetrübte Freude bei denen, deren weitere Verwendung auf irgendeiner Schiffseinheit fürs Erste gesichert schien.
Ich selbst war hin- und her gerissen: einerseits war ich grenzenlos erleichtert, daß ich nicht dem großen Haufen zugeordnet worden war, dem eine ungewisse Zukunft an der Landfront bevorstand, andererseits erschien es mir ungewiß, ob wir unseren Bestimmungsort im Osten überhaupt erreichen könnten, nachdem die Sowjetarmee in Hinterpommern bereits bis zur Ostseeküste vorgestoßen war und damit alle Landverbindungen unterbrochen hatte.
Gleichwohl tröstete ich mich damit, daß ich nicht allein vor diesem Transportproblem stand. Letzten Endes waren wir nämlich sieben Kameraden, die sich auf den gemeinsamen Weg nach Osten begeben mußten, denn außer uns drei Obengenannten waren noch vier Fähnriche der 11. Landungsflottille zugeteilt worden, die ebenfalls ihren Liegeplatz in der Danziger Bucht hatte. Bevor wir Kursteilnehmer uns in alle Himmelsrichtungen zerstreuten, beendeten wir diesen so unkonventionell abgelaufenen Torpedolehrgang im großen Gesellschaftsraum des an der Pier liegenden Passagierschiffes „Patria“ mit einem rauschenden Abschiedsfest, auf welchem wir uns von vielen Kameraden verabschiedeten, mit denen wir einen großen Teil unserer Ausbildung absolviert hatten und denen wir als Folge der weiteren Kriegsentwicklung später nie mehr begegnen sollten.
Abenteuerreise nach Gotenhafen
Am vorgesehenen Abfahrtstag erhielten wir unsere schriftlichen Marschbefehle und mußten uns dann selbst den passenden Reiseweg zu unserem Zielort heraussuchen. So ein Marschbefehl war in den letzten Kriegsmonaten, wo vieles schon nicht mehr in geordneten Bahnen verlief, äußerst wichtig, wenn man einzeln oder nur in ganz kleinen Gruppen unterwegs war, denn falls man bei den zahlreichen Kontrollen ohne einen solchen angetroffen wurde, konnte dies sehr leicht als „unerlaubte Entfernung von der Truppe“ angesehen werden, was unweigerlich ein Kriegsgerichtsverfahren mit seinen üblen Folgen nach sich zog.
Für uns sieben Fähnriche, die wir nach Gotenhafen zur 11. und 13. Landungsflottille kommandiert wurden, war die Reiseroute natürlich sehr problematisch, wußten wir doch, daß der direkte Landweg in den Osten Deutschlands bereits unterbrochen war. Demzufolge blieb uns nur die eine Möglichkeit, nämlich mit dem Zug bis zu einem Seehafen, und das war praktischerweise Swinemünde an der Odermündung, zu fahren und dort zu versuchen, ein Schiff zu finden, das demnächst mit Zielrichtung Danziger Bucht auslief.
So setzten wir uns denn in Flensburg in den nächstbesten Zug und kamen nach mehrmaligem Umsteigen und zweimaligem Übernachten, zuerst in einem komfortablen Schlafwagenzug weit außerhalb Hamburgs und dann umso primitiver im vollbesetzten Wartesaal des Bahnhofs von Pasewalk, am Morgen des dritten Tages in Swinemünde an. Dort wurden alle dem Zug entstiegenen Wehrmachtsangehörigen von uniformierten Kontrollposten in Empfang genommen, ihnen die Marschpapiere abverlangt und sie in die unweit gelegene Hindenburgkaserne dirigiert. Wir Fähnriche führten heftige Diskussionen mit diesen Leuten, die fast durchweg im Unteroffiziersrang standen, hielten ihnen vor, daß wir unbedingt nach Gotenhafen müßten und dort dringend erwartet würden – was natürlich so nicht stimmte -, aber alles Argumentieren half nichts. Man entgegnete uns höflich, aber bestimmt, daß die gesamte Region unter das Kommando der Waffen-SS gestellt sei, jeder verfügbare Soldat, gleich welchen Ranges, dringend für die Aufstellung von Einsatzeinheiten gebraucht würde, um sich einem weiteren Vordringen der Sowjettruppen östlich der Odermündung entgegenzustemmen Es blieb uns daher nichts anderes übrig, als unsere Marschbefehle abzugeben, die dann in die Schreibstube der Hindenburgkaserne gelangten, und uns ebenfalls in diesem Komplex zu melden. Dort führten wir in der Folge eine weitere ergebnislose Diskussion mit einem Heeresoffizier, der uns bedeutete, daß er gerade Leute wie uns bevorzugt zur Führung von Gruppen in der von ihm aufzustellenden Einheit benötige und daher einer Weiterreise unsererseits nicht zustimmen könne.
militärischer Lebenslauf v. Karl-Heinz Koppel
| Zeitraum | Aktivität |
| 01.07.1943 – 27.10.1943 | 7. Schiffsstammabteilung Stralsund - Dänholm (Grundausbildung) |
| 28.10.1943 – 30.04.1944 | Schwerer Kreuzer „Admiral Scheer“ (Seemännische Bordausbildung) |
| 01.01.1944 | Beförderung zum Seekadett d.R. |
| 01.05.1944 – 31.10.1944 | Marinekriegsschule Flensburg - Mürwik (Offiziersausbildung) |
| 01.07.1944 | Beförderung zum Fähnrich z.See d.R. |
| 01.11.1944 – 31.12.1944 | 1. Schiffsstammabteilung Stralsund – Dänholm (Zugführerlehrgang) |
| 01.01.1945 – 28.02.1945 | Torpedoschulen Regenwalde u. Flensburg–Mürwik (Torpedolehrgang) |
| 01.03.1945 – 20.05.1945 | 13. Landungsflottille Gotenhafen (Kommandantenschüler) |
| 21.05.1945 – 15.11.1945 | Bootskompanie der Royal Navy Kiel – Wik (Bootssteuerer) |
Doch der von uns ausgeheckte Plan glückte: Die zwei an Statur imposantesten Fähnriche, einer davon war Jochen Krebs, ein hochaufgeschossener und wortgewandter Hamburger, mit dem ich bereits auf „Scheer“ und in Mürwik in einer Division bzw. Kompanie zusammen war, kreuzten in der Schreibstube auf, gaukelten den dort arbeitenden Wehrmachtshelferinnen vor, ihnen auf Anordnung des zuständigen Offiziers die einbehaltenen Marschbefehle sofort auszuhändigen, was dank des forschen Auftretens der beiden auch gelang. Wir anderen hatten uns in der Zwischenzeit mit unseren Seesäcken in die Nähe des Kaserneneingangs begeben und erwarteten dort unsere zwei Kameraden. Unmittelbar nach deren Eintreffen hielten wir dem Posten, einem Mannschaftsdienstgrad, der natürlich vor uns Ranghöheren eine Ehrenbezeigung machen mußte, die Papiere unter die Nase, verließen also damit scheinbar ganz ordnungsgemäß die Kaserne und liefen dann, so schnell dies mit dem schweren Gepäck auf dem Rücken möglich war, in Richtung Hafen, immer wieder den Blick zurückwerfend, da wir eine vorzeitige Entdeckung unserer Flucht befürchten mußten. Jedoch erreichten wir unser Ziel unbehelligt, meldeten uns ganz formgerecht beim Flottillenchef, wurden von diesem auf die einzelnen Boote verteilt und verzogen uns bis zur Abfahrt unter Deck, um nicht noch in letzter Minute von irgendeinem Feldpolizisten zurückgeholt zu werden. Als gegen 18 Uhr endlich die Motoren angestellt, die Leinen losgeworfen wurden und die sechs S-Boote in Kiellinie die Swine hinunterfuhren, an der Stelle vorbei, wo ein Jahr zuvor unser „Admiral Scheer“ gelegen hatte, fiel uns allen ein großer Stein vom Herzen; wir waren vor dem drohenden Infanterieeinsatz bewahrt worden und blieben einstweilen der Kriegsmarine erhalten.
Die stundenlange Fahrt auf den schnellen Booten der Küste entlang wurde für uns, die wir vorher meist nur auf sogenannten „Dickschiffen“ gefahren waren, zu einem besonderen Erlebnis. Als es dunkelte, konnten wir an vielen Stellen auf dem Festland lodernde Brände beobachten, ein sicheres Zeichen, daß die Sowjets bereits bis in diese Gegenden vorgestoßen waren. Nachts gegen 1 Uhr machten unsere Boote in einem Gotenhafener Hafenbecken fest. Wir bedankten und verabschiedeten uns vom Flottillenchef und den einzelnen Bootskommandanten, deren kurzzeitige Gäste wir gewesen waren, für die Mitnahme und fanden irgendwie nach einigem Suchen noch in der Nacht das Stabsquartier unserer eigenen Flottille. In Gotenhafen selbst herrschte nach wie vor relative Stille, sah man einmal von den vielen Flüchtlingen ab, die zum großen Teil mit Pferdewagen, verschiedentlich heimisches Vieh mit sich führend, bis in diese Hafenstadt gelangt waren, dort meist auf freien Plätzen kampierten und auf eine Transportmöglichkeit über See nach Westen warteten, da ihnen ja der Landweg versperrt war.
Erste Einsätze bei der 13. Landungsflottille
Am Morgen nach unserer Ankunft wurden wir zuerst dem Chef der 13. L-Flottille, Korvettenkapitän Wassmuth, vorgestellt. Dann bemühte man sich, uns möglichst rasch auf Fährprähmen unterzubringen, was nicht so einfach war, denn die meisten Fahrzeuge befanden sich irgendwo in der Danziger Bucht im Einsatz. Darüber hinaus mußte erst herausgefunden werden, wo freie Plätze für die ordentliche Unterbringung eines zusätzlichen Besatzungsmitgliedes im Unteroffiziersdienstrang vorhanden waren. All dies dauerte einige Zeit, denn diese Bootskategorie besaß zum überwiegenden Teil weder Telefon- noch Funkverbindung, über die man kurzzeitig mit den einzelnen Kommandanten hätte in Verbindung treten können. Aus diesem Grund wurden wir vorübergehend anderen Einsatzstellen zugewiesen.
Ich wurde anfänglich in die Funkstation der Flottille beordert, die sich auf einem im Kriegshafen liegenden größeren Begleitboot unserer Flottille befand, dort rund um die Uhr ihren Betrieb aufrechterhielt und alle auf der Marinewelle „Östliche Ostsee“ gesendeten Funksprüche aufnahm oder, wenn es sich als notwendig erwies, eigene Nachrichten absandte. Sie war permanent von drei Mann besetzt, die im Dreischichtbetrieb jeweils vier Stunden ihren Dienst verrichteten. Zwei davon waren ausgebildete Marinefunker, welche an den Geräten saßen und die verschlüsselten Nachrichten mitschrieben. Der dritte Mann bediente die Ver- und Entschlüsselungsmaschine, die berühmte „Enigma“, welche nach einem sehr komplizierten System mit mehreren Walzenrädern und doppelpoligen Kabelverbindungen arbeitete. Diese Aufgabe wurde nun für einige Tage mir zugewiesen. Die technische Arbeitsweise des angewandten Systems hatten wir Fähnriche bereits im Signalkundeunterricht während unserer Kriegsschulzeit in Mürwik vermittelt bekommen, sodaß ich ohne große Probleme nach einer kurzen Einweisung voll eingesetzt werden konnte.
Der Funkdienst lief nun wie folgt ab: Die Funker, die stets abwechselnd die Morsezeichen abhörten und die aufgenommenen Buchstaben nacheinander aufschrieben, reichten mir die jeweiligen Meldungen zu. Ich tippte diese in die Maschine ein, las die aufleuchtenden Klarbuchstaben ab und schrieb sie auf. Den gesamten Funkspruch mußte ich dann in eine Kladde eintragen, die der Flottillenleitung regelmäßig oder in dringenden Fällen sofort vorgelegt wurde. Allerdings war meine Arbeit nicht immer einfach. Öfters kam es vor, daß die Morsezeichen von ihren Absendern etwas schludrig oder allzu schnell abgesetzt wurden, sodaß sie nicht eindeutig zu verstehen waren und sich hieraus Aufnahmefehler ergaben. Dies führte in der Folge beim Entschlüsseln zwangsläufig zu Verstümmelungen des Textes, und ich erinnere mich daran, daß wir manchmal gemeinsam Mühe hatten, den korrekten Sinn des Morsespruchs zu erraten.
Es war aber, alles in allem gesehen, eine sehr interessante Tätigkeit für mich, auch wenn sie wegen des Dreischichtbetriebes teilweise bei Nacht durchgeführt werden mußte. Um jedoch den Code der Enigma täglich zu ändern, wie dies die Vorschrift verlangte, war meine Tätigkeit an diesem Gerät zu kurz. Aber auch so habe ich beachtliche Erkenntnisse über die meisten Einsätze der Kriegsmarine in der östlichen Ostsee gewonnen, über die ich sonst nichts erfahren hätte. Allerdings blieb es hierbei nicht aus, daß man hin und wieder ganz banale Meldungen zugemorst bekam, auf die man gut und gerne hätte verzichten können.
Abends nach Einbruch der Dunkelheit starteten wir, unser Begleitboot voraus, die vier Prähme in Kiellinie hinterher. Da wir zwei Fähnriche keine besondere Aufgabe hatten, entließ uns der Kommandant nicht lange nach dem Auslaufen in unsere Kajüte, befahl uns aber, voll angekleidet mit umgebundener Schwimmweste zu schlafen, da in diesem Seegebiet stets U-Boot-Gefahr herrschte und auch ein gewisses Risiko bestand, einer explodierenden Mine zum Opfer zu fallen. Solange wir die freie See noch nicht erreicht hatten, gestaltete sich die Fahrt relativ ruhig, aber nach Umrundung der Halbinsel Hela wurde es langsam ungemütlich, der Wind frischte immer mehr auf, die Wellen wurden höher und gegen Morgen erreichte der Sturm eine solche Stärke, daß unser Boot nur noch mühsam vorwärts kam. Wir Neulinge an Bord hatten zwar bis dahin recht gut geschlafen, da wir bekanntlich an den Vortagen kaum zur Ruhe gekommen waren, wachten aber dann durch das heftige Schaukeln auf und mußten sogar befürchten, aus den Kojen herauszufallen. Doch dann fing auch schon mein Magen an zu rebellieren. Ich kam gerade noch an das im Raum installierte Waschbecken und schon „befreite“ ich mich von meinem guten Abendessen. Darauf hielt es mich nicht mehr unter Deck. Ich hatte nur ein Ziel: Hinauf an die frische Seeluft und mir den Sturmwind, der an Stärke noch zunahm und von schräg vorn kam, um die Ohren pfeifen zu lassen. Die hinter uns fahrenden Fährprähme konnten einem Leid tun. Da sie keinen Kiel, sondern einen ganz flachen Boden besaßen, waren sie den feindlichen Elementen noch heftiger ausgesetzt als wir.
Ungefähr gegen 7 Uhr langten wir vor Leba an, dessen Hafen von zwei in die See ragenden schmalen Molen geschützt wurde. Für die stark schaukelnden Fährprähme erwies es sich allerdings als unmöglich, einzulaufen, denn der starke Wellengang drohte sie gegen eine dieser Molen zu drücken und zu beschädigen. Also blieb unserem Verband nichts anderes übrig als zu wenden und unverrichteter Dinge nach Gotenhafen zurückzulaufen. Jetzt aber kamen die Wellen von schräg achtern, hoben unser kleines Boot mit dem Heck nach oben, drückten damit den Bug in ein Wellental und mit der nächsten Welle wieder aufwärts. Es war eine dramatische Fahrt, wie ich sie vorher und auch nachher nie wieder erlebt habe. Doch die alten Seehasen nahmen das Ganze eher gelassen hin, obwohl mit Ausnahme von nur zwei Mann, beide im Zivilberuf Fischer, einer davon der Kommandant, mehr oder weniger alle anderen Besatzungsmitglieder seekrank wurden, was für mich ein gewisser Trost war. An eine Mahlzeit wollte und konnte in dieser Situation niemand denken, Auch war es unserem Schiffskoch nahezu unmöglich, uns wenigstens mit heißem Kaffee zu versorgen, denn selbst aus einem nur zum geringen Teil gefüllten Kessel schwappte das Wasser infolge der dauernden Auf- und Abbewegungen des Bootes auf die nur mühevoll erhitzte Herdplatte. Als wir nachmittags glücklich Hela wieder erreicht und die langgestreckte Halbinsel umrundet hatten, gelangten wir endlich in ruhigeres Gewässer und liefen sofort in Gotenhafen ein. Auch unsere Mägen hatten sich inzwischen wieder normalisiert, sodaß wir ohne Gefahr beim folgenden Abendessen unseren Hunger stillen konnten. Dies sollte allerdings für mich die einzige Fahrt auf diesem Begleitboot sein, denn am folgenden Tag wurden wir zwei Fähnriche ins Stabsquartier der Flottille zurückbeordert, um uns dort mitzuteilen, daß wir jetzt endlich, es war bereits Mitte März, auf Fährprähmen eingesetzt würden. Entsprechend dieser Direktive sollte ich mich sofort beim Kommandanten des Fährprahms F 210, der gerade im Hafen lag, melden und mit der Bezeichnung „Kommandantenschüler“ als zusätzliches Besatzungsmitglied auf diesem Boot meinen Dienst antreten.
An Bord des Marinefährprahms F 210
Die erste Begegnung mit F 210 sollte für mich beinahe verhängnisvoll werden. Wie mir vom Flottillenkommando angegeben, traf ich diesen mir zugewiesenen Fährprahm an der Pier eines Hafenbeckens festgemacht. Sein Kommandant, Oberbootsmann Bendig, stand zufällig an Land zusammen mit anderen Besatzungsmitgliedern. Ich stellte mich vor, kam mit ihm ins Gespräch, - da vernahmen wir ganz unvermittelt ein stark anschwellendes Motorengeräusch. Ein Blick in den Himmel genügte, um die akute Situation zu erfassen: Eine ganze Staffel von zweimotorigen russischen Bombenflugzeugen flog genau in unsere Richtung. Sie hatten es offensichtlich auf den Kreuzer „Leipzig“ abgesehen, der im benachbarten Hafenbecken lag und von dort aus mit seiner Bordartillerie feindliche Stellungen außerhalb von Gotenhafen beschoß. Die beiden Hafenbecken waren nur durch eine relativ schmale Landzunge voneinander getrennt, darauf befand sich ungefähr in ihrer Mitte, direkt auf der Höhe unseres Fährprahms, ein einstöckiger massiv gebauter Lagerschuppen.
Bei Ansicht der auf uns zufliegenden Feindmaschinen brach der Kommandant von F 210 das Gespräch mit mir abrupt ab, rannte mit seinen Leuten zu seinem Boot, um sofort abzulegen. Da ich mein Gepäck noch nicht dabei hatte, mußte ich einstweilen zurückbleiben. Andere in meiner Nähe befindliche Menschen hatten die nahende Gefahr noch nicht ausgemacht: Ich ging daher, um nicht als Angsthase dazustehen, etwas zögernd zum nahen Lagerschuppen und versuchte, durch eine schwere Holztür in sein schützendes Innere zu gelangen, fand aber diese Tür verschlossen. In diesem Augenblick gab es einen ohrenbetäubenden Knall von einer Bombendetonation, die Holztür des Schuppens wurde durch den Luftdruck schlagartig aufgerissen, krachte mit Wucht auf mich drauf und riß mich zu Boden. Die Bombe muß irgendwo im Innern dieses Schuppen explodiert sein. Noch im Fallen dachte ich an das Schlimmste. Aber als ich am Boden lag, lebte ich immer noch, ich konnte es zuerst nicht glauben. Ich rappelte mich mühsam hoch und untersuchte mich von oben bis unten nach etwaigen blutenden Wunden. Es mußten doch bestimmt Bombensplitter durch die Gegend geflogen sein! Aber wie durch ein Wunder war ich unversehrt geblieben. Ich klopfte meine stark verschmutzte blaue Uniform ab, klaubte meine Dienstmütze auf, die irgendwohin gerollt war und hielt Ausschau nach meinem Fährprahm. Aber der hatte bereits einige Meter Wasser zwischen sich und die Pier gebracht und fuhr dann auch schleunigst in Richtung Hafenausfahrt davon. So ganz allmählich begannen dann auch verschiedene Körperteile, die direkt Bekanntschaft mit der aufgerissenen Schuppentür gemacht hatten oder mit denen ich auf den harten Boden aufgeschlagen war, zu schmerzen, aber außer Prellungen und Verstauchungen, die einige Tage anhielten und blaue Flecken hinterließen, mußte ich keinerlei Verletzungen beklagen. Ich hatte wirklich noch mal Dusel gehabt!
An einem der nächsten Tage konnte ich dann endlich mit meinem Gepäck auf dem Marinefährprahm F 210 einsteigen, der sich in seiner äußeren Erscheinung etwas von den meisten übrigen Booten dieses Schiffstyps unterschied. Denn er besaß über dem niederen Steuerstand einen hölzernen Aufbau, der als Kommandobrücke diente und hatte an Steuer- und Backbord seitliche Ausbuchtungen, auf denen Schienen zur Aufnahme von Seeminen angebracht waren. Anfangs kam ich mir an Bord wie ein Greenhorn vor, was sich zum Teil auch in der mir verliehenen Dienstbezeichnung „Kommandantenschüler“ niederschlug, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf dem Wortteil „Schüler“ lag. Auf alle Fälle wurde ich, wie ich noch weiß, freundlich empfangen und der Besatzung vorgestellt Man wies mir im vorderen Mannschaftsraum – die Unteroffizierskajüte war voll belegt - eine Koje und einen geräumigen Kleiderspind zu. Ich merkte gleich, doch dies überraschte mich nicht, daß hier wesentlich gelockertere Umgangsformen herrschten als auf einem Dickschiff, wie „Admiral Scheer“ es war. Dort nahezu 1200 Mann, hier gerade mal um die zwanzig. Man sprach zwar auch in einem zivileren Ton miteinander, aber man behielt trotzdem den nötigen Abstand zu den Vorgesetzten, der ja alles in allem nicht sehr groß war, da kein Offizier an Bord Dienst tat.
Außer dem Kommandanten, wie gesagt im Bootsmannsrang, gab es noch drei Maate, einer davon war für die Technik zuständig. Nur der Kommandant verfügte über eine Einzelkajüte, doch diese diente gleichzeitig als Messe für uns fünf Unteroffiziersdienstgrade. Durch dieses mehrmalige Beisammensein am Tag während der Mahlzeiten wurde auch der außerdienstliche Kontakt untereinander vertieft. Im Übrigen spürte ich nach nur wenigen Tagen, daß auf diesem Boot eine eingespielte Mannschaft ihren Dienst versah, die ihre Aufgaben genau kannte und der man für die Routineeinsätze keine besonderen Anweisungen erteilen mußte. Ich selbst fand bei allen Fahrten meinen Platz auf der Brücke neben dem Kommandanten und einem Signalgasten. Bei Be- und Entladungstätigkeiten im Hafen, an Flußufern oder längsseits von größeren Schiffen übte ich darüber hinaus, sofern erforderlich, eine Überwachungs- und Einweisungsfunktion aus. Nach einiger Zeit durfte ich auch, natürlich unter strenger Beobachtung des Kommandanten, der um sein Boot sehr besorgt war, seemännische Manöver fahren, um mich ganz langsam an die Führung eines Landungsbootes mit seinen besonderen Manövriereigenheiten heranzutasten.
Viel Zeit, um mich in aller Ruhe an Bord meines neuen fahrbaren Untersatzes einzuleben, blieb mir in dieser zweiten Märzhälfte nicht. Dazu war die militärische Lage in der Danziger Bucht zu kritisch, denn die Rote Armee drängte an vielen Stellen in Richtung Küste und bemühte sich, schnellstmöglich den starken deutschen Widerstand zu brechen, um dann den Großteil ihrer Truppen für den bevorstehenden Angriff auf Berlin abziehen zu können.
Indes lagerten noch immer in der Umgebung von Danzig Zehntausende von Zivilisten, die es nach wochenlanger Flucht bis dorthin geschafft hatten, des weiteren warteten viele verwundete Soldaten, notdürftig untergebracht und versorgt in Notlazaretten, auf ihre Evakuierung. Andererseits mußten alle diese Menschen mit einem Minimum an Nahrung versorgt werden, auch benötigten die kämpfenden Truppenteile Munitionsnachschub. Normale Häfen für einen geordneten An- und Abtransport von Menschen und Material standen in dieser Gegend nicht mehr zur Verfügung oder waren so exzessiv feindlichen Luft- oder Artillerieangriffen ausgesetzt, daß man aus Angst vor allzu großen Verlusten auf sie nicht mehr zurückgriff.
In dieser Situation waren die Marinefährprähme das meistgefragte Transportmittel. Sie waren gleichsam die Lastesel, die unermüdlich die von den Handelsschiffen aus dem Westen mitgebrachten Materialien, fast durchweg Proviant und Munition, in ihren geräumigen Ladedecks verstauten, sie über die Danziger Bucht zu den provisorischen Ausladeplätzen beförderten, um im Gegenzug für die Rückfahrt mit Flüchtlingen oder Verwundeten beladen zu werden, die sie dann entweder nach Hela oder zum Teil auch gleich zu den auf Reede wartenden Schiffen mitnahmen.
Alle diese Einsätze vieler Marineeinheiten bedurften einer sorgfältigen Planung. Hierzu wurde dann auf Hela, als der Fall von Gotenhafen nahe bevorstand, eine Seeleitstelle ins Leben gerufen, welche die bis zuletzt einwandfrei funktionierende Koordination zwischen Heer, Marine und den für Unterbringung und Verpflegung der vielen Flüchtlinge verantwortlichen Zivilstellen sicherstellte.
Indes, so schön und friedlich, wie sich dies hier liest, spielte sich der Schiffsverkehr in diesem Seegebiet nicht ab. Denn die Russen versuchten, so gut es ging, die Transporte über See und die Einschiffungen zu vereiteln oder sie zumindest für die deutsche Seite so verlustreich wie möglich zu gestalten. Anfänglich setzten sie vor allem Schlachtflugzeuge vom Typ IL 2 in großer Zahl ein, daneben auch zweimotorige Bomben- und Sturzkampfflugzeuge, die sich ohne Rücksicht auf den starken deutschen Flakriegel, der von Kriegsschiffen rings um die Schiffsansammlungen gebildet worden war, jeweils auf die größten Pötte stürzten und dabei selbst schwere Verluste erlitten, wie wir stets, wenn wir uns nahe oder inmitten des Kampfgeschehens befanden, beobachten konnten.
An manchen Tagen, wenn die Wetterlage es ihnen ermöglichte und lohnende Ziele lockten, kamen sie fast stündlich in mehreren Wellen, und es entwickelte sich jedesmal ein Höllenlärm, gemischt aus dem Motorengeräusch sich herabstürzender Flugzeuge und dem ihnen aus vielen Flakrohren entgegenschlagenden Abwehrfeuer. Später, als die Küste um Gotenhafen herum in ihrer Hand war, richteten die Russen zusätzlich Geschützstellungen ein und begannen, über die ganze Bucht hinweg Hela zu beschießen, wurden aber, solange hier noch größere deutsche Kriegsschiffe anwesend waren, durch Gegenfeuer zum Schweigen gebracht. Und schließlich machten auch noch im Laufe des Monats April russische Schnellboote bei Nacht das Seegebiet unsicher, erzielten aber nur geringe Erfolge.
Fertigungsaufwand
| Typ | Eisenbedarf | Holzbedarf | Arbeitsaufwand* |
| MFP A | 180 Tonnen | 20 Kubikmeter | 32.000 Mannstunden |
| MFP D | 225,5 Tonnen | 35 Kubikmeter | 38.500 Mannstunden |
| MNL I | 96 Tonnen | 20 Kubikmeter | 27.000 Mannstunden |
*ohne Bewaffnung, Motore und Gerät
Obiges Szenario war also das Umfeld, in dem wir von März bis zum Tage der Kapitulation unsere fast täglichen Einsätze fuhren. Anfänglich nach meinem Einstieg auf F 210 war unser Bestimmungsort durchweg Bohnsack oder Neufähr in der Toten Weichsel, nur unweit von Danzig entfernt. Wir wurden regelmäßig zu eingetroffenen Handelsschiffen dirigiert, füllten unseren Laderaum meist mit Proviant und eigenartigerweise wiederholt auch mit Pferdefutter für die bespannten Heerestruppen und fuhren dann bei Tage zur vorbezeichneten Abladestelle. Hin und wieder registrierten wir, wenn wir uns bereits im Flußlauf der Weichsel befanden, einige Granatwerfereinschläge an für den Gegner einsehbaren Stellen, die offenbar uns galten, aber meist weit daneben lagen.
Zuweilen konnte es uns passieren, daß sich an den Anlegeplätzen niemand für zuständig erklärte, uns das mitgebrachte Pferdefutter abzunehmen, weil man offenbar nichts damit anfangen konnte. Zumeist wurde dann ich vom Kommandanten beauftragt, irgendeine Kontaktperson an Land ausfindig zu machen, die einen Trupp Soldaten oder russische Gefangene zum Ausladen schickte. Öfters bemerkte ich hierbei, daß ich mir allein durch meine Fähnrichsuniform, deren schmale Schulterstücke auf viele unkundige Heeresangehörige wie die eines Leutnants wirkten, Respekt verschaffen konnte, was mir in manchen kritischen Situationen sehr half.
Auf den Rückfahrten nach Hela wurden wir dann vollgestopft, entweder mit Flüchtlingen, meist Frauen und Kindern, zu denen sich vereinzelt ältere nicht mehr volkssturmtaugliche Männer gesellten, oder auch mit verwundeten Soldaten. Die Flüchtlinge versuchten wir, so gut es für die nur rund zweistündige Fahrt ging, geschützt gegen Wind und manchmal auch gegen Regen, unter Deck im Laderaum unterzubringen. Aber manchmal drückte man uns derart viele Personen an Bord, daß eine große Anzahl von ihnen sich auf dem freien Oberdeck einen Platz suchen mußte.
Bei jeder dieser Fahrten hatten wir ein großes sanitäres Problem, das ich hier offen zur Sprache bringen möchte, über das ich jedoch noch in keinem Bericht über die damaligen Transporte etwas gelesen hatte. Und dies betraf die völlig unbefriedigende Toilettensituation. Die Fährprähme verfügten bei ihrer geringen Beatzung nur über eine einzige Toilette auf dem Oberdeck, jedoch ohne Wasserspülung, also ein sogenanntes „Plumpsklo“. Wenn sich nun einige hundert Frauen und Kinder an Bord befanden, bildeten sich rasch lange Schlangen vor dem besagten einzigen Örtchen. Wir von der Besatzung richteten uns zwar rechtzeitig darauf ein, dieses während der Fahrt nicht zu benutzen, aber nach Ausschiffung unserer kurzzeitigen Gäste war es oft eine Zumutung für die zur Reinigung eingeteilten Besatzungsmitglieder, hier wieder den alten Sauberkeitsstandard herzustellen.
Bei den Verwundetentransporten konnte für uns ein ganz anderes Problem entstehen, wobei ich mich an eine bestimmte Fahrt in den letzten Märztagen von der Toten Weichsel aus erinnere. Man trug aus einem Notlazarett so viele Schwerverwundete auf Bahren auf unser Boot, bis der Laderaum voll war. Einige Krankenschwestern und zivile Helferinnen wurden zur Begleitung und Betreuung mitgeschickt.
Es war an jenem Tag bereits dunkel, als wir in Hela ankamen und bereitstehende Sanitätskommandos den Abtransport bewerkstelligten. Als der Laderaum scheinbar leer und die für seine Reinigung eingeteilten Besatzungsmitglieder mit ihrer nicht gerade angenehmen Arbeit beginnen wollten, mußten sie feststellen, daß die Sanitäter einige schwerverwundete Soldaten, die den Transport nicht überlebt hatten, einfach tot zurückgelassen hatten. Sie fühlten sich für diese Fälle offenbar nicht zuständig und ließen uns mit der Aufgabe der „Entsorgung“ allein.
Und wieder einmal beauftragte unser Kommandant seinen Fähnrich, also mich, irgendwo auf Hela eine für solche Fälle verantwortliche Dienststelle ausfindig zu machen. Ich weiß heute nicht mehr, wie und wo ich eine solche gefunden habe. Aber es gab damals auf der Halbinsel tatsächlich sogenannte hauptamtliche Beerdigungskommandos, die alsbald nach meiner Anforderung an Bord kamen, den Toten die Erkennungsmarken abnahmen und sie anschließend zum Friedhof brachten. Zum Glück hatten wir uns mit einem solchen Problem nur ein- oder zweimal während meiner gesamten Bordzeit zu befassen.
Ganz kurz möchte ich hier noch zwei andere mir im Gedächtnis gebliebene Einsätze in den letzten Märzwochen einfließen lassen, um dem Leser zu demonstrieren, auf welche vielfältige Weise die Fährprähme in diesem Seegebiet Verwendung fanden.
Einmal lud man uns an einem zu räumenden Frontabschnitt schwere Sturmgeschütze ein, von deren Typ wir ihres Gewichts wegen nur zwei Stück im Laderaum unterbringen durften, um sie an anderer Stelle wieder ausfahren zu lassen. Ein anderes Mal legten wir an einem Handelsschiff an, übernahmen eine bestimmte Menge Artilleriemunition, getrennt in Granaten und Kartuschen, brachten sie zu dem nördlich von Gotenhafen gelegenen Hexengrund am Fuße der Oxhöfter Kämpe, wo ein Kommando, bestehend aus deutschen Zivilisten und französischen Zwangsarbeitern, am dortigen Landungssteg bereitstand, um diese hochexplosive Fracht auf Lkws für den Transport an die Front zu verladen.
Als aber kurz nach unserem Anlegen einige russische Granatwerfereinschläge in nächster Nähe zu verzeichnen waren, verschwanden die Deutschen schnurstracks und ließen die Franzosen zur Erledigung dieser Arbeit fast allein. Nur einige Mitglieder unserer Besatzung halfen ihnen hierbei, damit sich unser Fährprahm schnellstmöglich aus der Gefahrenzone entfernen konnte. Wir alle waren froh, als wir diese heikle Ladung von Bord hatten; schließlich hätte ein einziger Treffer schwerwiegende Folgen für uns alle gehabt.
Einige Tage später, es war am 28. März, wurde Gotenhafen von der Roten Armee besetzt. Die deutsche Marineleitung wollte jedoch verhindern, daß der Gegner auch den Kriegshafen allzu schnell für die Stationierung eigener Schiffe benutzen konnte. Aus diesem Grund beschloß sie rechtzeitig sowohl eine Verminung der Hafenbecken als auch eine Sperrung der Einfahrt.
Wie ich bereits weiter oben bei der Beschreibung unseres Fährprahms aufgezeigt habe, verfügte dieser über die technische Einrichtung, Seeminen an Bord zu nehmen und anschließend zu verlegen. F 210 war damit neben seinem Schwesterboot F 274, das ebenfalls zu unserer Gruppe gehörte, nach meiner damaligen Feststellung eines der wenigen Fahrzeuge innerhalb der Flottille, das einen solch riskanten Auftrag ausführen konnte.
Wahrscheinlich lag der Aktionsplan schon eine Zeitlang bei der Marineleitung in der Schublade, denn wir erhielten eines schönen Tages den Befehl, an einem auf Reede, aber etwas abseits vor Anker liegenden Handelsschiff längsseits zu gehen und etwa zwanzig Magnetminen zu übernehmen. Diese Minen waren recht dicke, fast eiförmige Brocken, die, mit starken Gurten auf vierrädrige Untersätze geschnallt, auf die seitlich angebrachten Schienen aufgesetzt wurden. Möglichst rasch entfernten wir uns nach vollzogener Übernahme in eine geschützte Ecke vor Hela, um nicht unversehens durch einen der häufigen russischen Luftangriffe gefährdet zu werden.
In der Nacht vom 27. auf 28. März sollten wir dann als allerletztes deutsches Schiff in den Kriegshafen von Gotenhafen einlaufen und die Minen verlegen. Die Leitung dieses Unternehmens war einem Oberleutnant aus unserem Flottillenstab übertragen worden, der mit einem Lageplan der Hafenbecken und den darin eingezeichneten Punkten, an denen die Minen geworfen werden sollten, am Abend bei Einbruch der Dunkelheit zu uns an Bord kam. Langsam bewegten wir uns auf den Hafen zu, es durfte an Deck nur im Flüsterton geredet werden, jegliche Beleuchtung war absolut untersagt, die Motoren wurden auf Schleichfahrt gedrosselt, um nicht auf uns aufmerksam zu machen. Wir wußten ja nicht, ob die Russen schon bis zum Hafen vorgedrungen waren.
Unsere Nerven waren deshalb aufs Äußerste gespannt, so erschreckte uns jedes unbestimmte Geräusch am Ufer und jeder entfernte Schuß oder Granateinschlag, wir starrten angestrengt in die Dunkelheit rings um uns her, aber kein Lebewesen war auszumachen. Der Oberleutnant stand mit seinem Verlegeplan im geschlossenen Steuerhaus, benutzte nur eine schwache Taschenlampe zu seiner Orientierung und gab dann mit leiser Stimme durch eine Sichtluke hindurch mit dem nur für die Nahestehenden zu vernehmenden Kommando: „Mine wirf!“ den Befehl zum Abkippen der jeweils folgenden Mine.
Wir alle an Bord schoben Mine um Mine über die Gleisanlage zum Heck. Irgendwie half uns diese Tätigkeit, zu der auch ich mich ganz freiwillig gesellte, die in uns aufgestaute Spannung etwas zu lockern. Schließlich, als wir alle Explosivkörper an den vorbezeichnenden Stellen ins Hafenbecken versenkt hatten, machten wir kehrt und wandten uns der Einfahrt zu. Aber was wir da auf kurze Distanz trotz Dunkelheit vor unseren Augen auftauchen sahen, ließ uns förmlich das Blut in den Adern stocken. Denn ganz langsam glitt, von mehreren Schleppern gezogen, die hohe Bordwand eines großen Seefahrzeugs quer vor die Hafeneinfahrt. Es war das Schlachtschiff „Gneisenau“, das seit 1941 nach schwerer Beschädigung fahruntüchtig an irgendeiner Pier in Gotenhafen festgelegen war. Es sollte jetzt direkt vor dem Hafen auf Grund gesetzt werden.
Aber anscheinend wollten die Schlepperboote, um schnellstmöglich aus der Gefahrenzone zu gelangen, ihre Aufgabe früher als vorgesehen erledigen und waren daher der vereinbarten Zeit etwas voraus. Was sollten wir in dieser Situation tun? Wir mußten uns unbedingt der Besatzung auf den Schleppern zu erkennen geben. Das war ein großes Risiko für uns, aber es funktionierte. Mit der Klappbuchse und vor die Lichtöffnung aufgesetztem Blaufilter gab einer unserer Signalgasten einen Warnspruch ab und wurde tatsächlich verstanden.
Die extrem langsame Fahrt der „Gneisenau“ erlaubte es den Schleppern, ihren Klienten so rechtzeitig zu stoppen, daß wir unseren Fährprahm gerade noch durch eine schmale Öffnung durchmanövrieren und die offene See gewinnen konnten. Dann rauschten wir mit „voller Fahrt voraus“ in Richtung Hela und waren grenzenlos erleichtert, daß wir dieses Abenteuer, das beinnahe einen verhängnisvollen Ausgang genommen hätte, unbeschadet überstanden hatten.
Nur wenige Tage nach diesem riskanten Einsatz wurde unser Fährprahm in eine andere herausragende Rettungsaktion deutscher Soldaten und Flüchtlinge einbezogen. Hierzu bedarf es für einen Leser, der mit der damaligen militärischen Situation und dem geographischen Umfeld nicht vertraut ist, einer kurzen Vorbemerkung meinerseits.
Nach der Besetzung Gotenhafens am 28. März 1945 zogen sich die stark dezimierten Verbände des VIÍ. Deutschen Panzerkorps in nördlicher Richtung zurück und konzentrierten sich befehlsgemäß auf die Verteidigung eines entlang der Küste liegenden Höhenrückens, genannt die „Oxhöfter Kämpe“. Dieses felsige Hochplateau hat eine Ausdehnung von etwa fünfzehn Kilometern, steigt teilweise bis mehr als fünfzig Meter hoch schroff aus der Niederung empor und fällt auf der anderen Seite ebenso steil zum Meeresstrand hinab, wo sich an einer Stelle der bereits von mir erwähnte und von unserem Fährprahm bei anderer Gelegenheit angesteuerte Hexengrund befindet.
Die Rote Armee setzte starke Kräfte ein, um dieses letzte deutsche Bollwerk in diesem Raum zu eliminieren und dadurch ihre Truppen für den Sturm auf Berlin freizubekommen. Über die Stärke der deutschen Verbände und der noch auf ihre Einschiffung wartenden Flüchtlinge habe ich bei meinen Recherchen in verschiedenen Berichten widersprüchliche Zahlen vorgefunden, aber insgesamt harrten noch zwischen dreißig- bis vierzigtausend Deutsche, sowohl Soldaten als auch Zivilisten, in dieser Gegend aus.
Als in den ersten Apriltagen offenbar wurde, daß die Stellungen auf der Oxhöfter Kämpe nicht mehr zu halten waren und den dort kämpfenden Truppen die Gefangenschaft drohte, erhielt die 9. Sicherungsdivision den Auftrag, mit einem Teil der ihr unterstehenden Flottillen in der Nacht vom 4. auf 5. April die Räumung möglichst unbemerkt vom Gegner durchzuführen, um unnötige Verluste zu vermeiden. Ungefähr sechzig Fahrzeuge unterschiedlicher Bauart wurden für dieses ehrgeizige Unternehmen, das unter der Bezeichnung „Walpurgisnacht“ ablaufen sollte, eingesetzt, darunter fünfundzwanzig Fährprähme der 13. und 24. Landungsflottillen, da sie auf kurze Entfernung zwischen Hela und der Festlandsküste die größte Ladekapazität besaßen und außerdem wegen ihres geringen Tiefgangs überall anlegen konnten.
In mehreren Wellen fuhren wir ab Einbruch der Dunkelheit nacheinander los, jedem Boot wurde eine bestimmte Anlegestelle, von denen es mehrere gab, zugewiesen. Irgendwelche Außenbeleuchtung war wie bei allen solchen Einsätzen strikt untersagt, obwohl bei dem dichten Pendelverkehr in der Finsternis auf nur begrenztem Raum stets die Gefahr einer Kollision mit entgegenkommenden Fahrzeugen bestand. Als wir selbst mit F 210 noch vor Mitternacht an der uns vorbezeichneten Anlegestelle am Fuße der Kämpe anlangten, wartete bereits eine große Anzahl Soldaten, alle zur 7. Panzerdivision gehörend und nur ihre leichten Handwaffen mit sich führend, auf ihren Abtransport. Nachdem wir unsere Landeklappe heruntergelassen hatten, stürmten sie förmlich unseren Fährprahm, als ob sie Angst hätten, im letzten Augenblick noch von den Sowjets geschnappt zu werden. Sie suchten sich ein Plätzchen entweder im Laderaum oder an Oberdeck und waren glücklich, als wir unverzüglich ablegten und sie nach etwa einer Stunde in Hela aussteigen ließen.
Nach einem kurzen Aufenthalt schickte uns die Einsatzleitung in den frühen Morgenstunden nochmals an die Küste zur Aufnahme weiterer Truppenteile. Als wir dort eintrafen, war es bereits hell und alle Bewegungen an Land und auf See waren gut zu beobachten. Jetzt wurde es so langsam kritisch, denn es stand zu befürchten, daß die Russen die Absetzoperation bemerkten und die Anlegestellen sowohl unter Artilleriefeuer nehmen als auch mit Bodentruppen zur Küste nachstoßen würden.
Aber noch blieb alles ruhig mit der einen Ausnahme, daß jetzt diejenigen Truppeneinheiten, die bis zuletzt die vorderste Stellung gehalten hatten, nach und nach am Strand eintrafen. Sie rutschten, stolperten, purzelten förmlich die hier nur dreißig bis vierzig Meter hohe Steilküste hinunter, schleppten teilweise noch ihre bei den letzten Gefechten verwundeten Kameraden mit und ließen sich, sobald sie Schiffsboden unter den Füßen spürten, atemlos und erschöpft zu Boden sinken, ehe sie einen passenden Platz für die Überfahrt fanden.
Bei diesem zweiten Einsatz durften wir nicht sofort wieder ablegen, denn der an der Anlegestelle postierte Verladeoffizier ließ uns zuwarten, da immer noch Nachzügler, die einen weiteren Weg zurückzulegen hatten, unterwegs sein konnten. Etwa um 6 Uhr morgens, wir waren bereits leicht nervös geworden, war der Strand dann völlig leer, niemand erschien mehr, und wir durften endlich ablegen. Indes, kaum hatten wir ein wenig Abstand zur Küste gewonnen, - wir trauten unseren Augen nicht – rutschte nochmals ganz überraschend eine Handvoll deutscher Soldaten – keiner wußte, woher sie kamen – den steilen Abhang der Kämpe herunter und winkte verzweifelt unserem davonlaufenden Fährprahm nach.
Obwohl dies sehr riskant erschien, drehte unser Kommandant kurz entschlossen nochmals um und fuhr zurück zum Anlegesteg, um auch diese allerletzten Soldaten an Bord zu nehmen. Doch kaum hatten wir erneut Fahrt aufgenommen – wir waren erst wenig mehr als hundert Meter vom Strand entfernt – ging genau dort ein Hagel von Granatwerfergeschossen nieder. Die Russen waren also aufgewacht, aber glücklicherweise für uns zu spät, sodaß wir nach einer Stunde Fahrt, unbehelligt von weiteren Angriffen, unsere dankbaren kurzzeitigen Gäste im Kriegshafen von Hela verabschieden konnten.
Nachzutragen bleibt zum guten Ende, daß der Chef der 9. Sicherungsdivision, Fregattenkapitän von Blanc, für diesen gefahrvollen Einsatz, der dank der Umsicht aller beteiligter Stellen ganz ohne Verluste abging, zu einem späteren Zeitpunkt das Eichenlaub zum Ritterkreuz verliehen bekam.
Zwei Tage nach der Besetzung von Gotenhafen, also am 30. März, hatte die Rote Armee Danzig erobert und nachträglich in Brand gesteckt. Mehrere Nächte war der Himmel über dieser einstmals schönen Stadt blutrot gefärbt. Mir tat es beim Anblick dieses schaurig schönen Bildes in der Seele weh, wenn ich daran dachte, daß ich noch im Jahr zuvor mehrere Male die alte Hansestadt mit ihren zahlreichen baulichen Sehenswürdigkeiten besucht hatte, die jetzt ein Opfer des Krieges geworden waren.
Mit der Inbesitznahme von Danzig war die gesamte Küstenlinie von der Toten Weichsel bis hinauf zum Ansatz der Halbinsel Hela in sowjetischer Hand. Dadurch verlagerte sich auch in den darauffolgenden Wochen unser Einsatzgebiet. Denn noch immer befand sich die Weichselniederung, von der große Teile geflutet waren und die dadurch besser verteidigt werden konnte, in deutscher Hand. In dieses Gebiet hatten sich in den letzten Märztagen Tausende von Flüchtlingen gerettet, und auch starke Truppenteile waren zwangsläufig bis hierher zurückgedrängt worden. Sie alle mußten jetzt mit Proviant und Munition versorgt werden, die nach wie vor von Handelsschiffen aus dem Westen herangeschafft wurden. Im Gegenzug waren dann die Flüchtlinge nach Hela mitzunehmen.
Für uns von der 13. Landungsflottille hießen also ab jetzt die Ziele der täglichen Einsatzfahrten, die sich jedoch mit der Zeit wegen der feindlichen Lufttätigkeit zunehmend immer mehr in die Nachtstunden verlagerten, Schiewenhorst auf dem linken und Nickelswalde auf dem rechten Ufer der Weichselmündung. Da an beiden Orten keine passenden Hafenanlagen existierten, mußten unsere Fährprähme – für andere Bootstypen wegen deren Bauart kaum möglich – an den befestigten Uferstreifen anlegen.
Soweit ich mich erinnere, haben wir mit F 210 in den folgenden Wochen bis zur Kapitulation nur noch Fahrten zu diesen beiden Orten durchgeführt. Anfangs fuhren wir noch am Tage los, nachdem wir vorwiegend Proviant übernommen hatten. Es war aber jetzt kein Pferdefutter mehr dabei, mit dem wir vorher wiederholt Schwierigkeiten beim Abladen gehabt hatten. Die Rückfahrten, voll bepackt mit Flüchtlingen, fanden in der ersten Aprilhälfte noch am folgenden Vormittag statt, um eventuell gleich die Verladung auf Handelschiffe vornehmen zu können, sofern solche auf Reede lagen. Andernfalls legten wir im Kriegshafen von Hela an und ließen dort die mitgenommenen Zivilisten aussteigen.
Wie ich weiter oben schon angemerkt habe, gingen die Verladeaktionen auf Hela-Reede nicht eben sehr friedlich über die Bühne, da die Sowjets die Evakuierungsmaßnahmen der deutschen Kriegsmarine unter allen Umständen zu verhindern suchten. Dabei nahmen sie keine Rücksicht auf Lazarettschiffe, die der Genfer Konvention entsprechend deutlich sichtbar weiß angestrichen waren und ausschließlich verwundete deutsche Soldaten sowie Frauen und Kinder an Bord nahmen. Ich selbst wurde in mindestens zwei Fällen Augenzeuge, wie solche Schiffe, die sich ja nicht selbst verteidigen konnten, da sie unbewaffnet waren, Opfer gezielter Angriffe wurden.
Als besonders verlustreicher Tag ist mir noch der 11. April in Erinnerung geblieben. Wir hatten wie gewöhnlich zusammen mit anderen Fährprähmen unserer Flottille vormittags insgesamt 2700 Flüchtlinge zu dem auf Reede liegenden Handelsschiff „Moltkefels“ gebracht, das außerdem etwa tausend Verwundete sowie aus einem für uns unverständlichen Grund einige Lkws geladen hatte und auf die nächtliche Geleitfahrt in den Westen wartete.
Die russische Luftwaffe, die vormittags bereits aktiv gewesen war, flog nachmittags mit etwa 35 Maschinen einen bewußten Angriff auf die „Moltkefels“ und erzielte im Mittel- und Vorschiff mehrere Bombentreffer, die heftige Brände verursachten, in der Folge eine große Panik unter den dort befindlichen Flüchtlingen auslösten und mehreren Hundert von ihnen zum Verhängnis wurde. Mit einigen anderen Fahrzeugen wurde unser Fährprahm zu einer groß angelegten Rettungsaktion zur „Moltkefels“ gelenkt.
Wir legten direkt an der Bordwand des Achterschiffes an, machten mit Leinen fest und begannen mit der Aufnahme von Flüchtlingen. Dabei waren wir nur eine sogenannte Übergangsstation. An Fallreeps, Gitternetzen und sogenannten Netzbrooken, die von der Besatzung an der hohen Bordwand herabgelassen worden waren, kletterten alte Männer, Frauen und Kinder mühsam auf unser Boot herab, manche konnten sich nicht festhalten, knallten mehrere Meter auf das Eisendeck hinab oder wurden von bereitstehenden Helfern unserer Bootsbesatzung aufgefangen. Einige wenige fielen zwischen der Bordwand des Havaristen und unserem Boot ins Wasser und mußten herausgefischt werden, aber alle wurden unmittelbar nach Übernahme weitergereicht an neben uns festgemachte andere Boote, die sie dann abtransportierten. Wir wußten auch von der Beatzung des getroffenen Schiffes, daß in seinen unteren Laderäumen noch viele Schwerverwundete eingeschlossen waren, für die kaum Aussicht auf Rettung bestand. Und schon hörten wir vereinzelt Schüsse, mit denen völlig Verzweifelte, die sich mit ihrem Schicksal abgefunden hatten, ihrem Leben selbst ein Ende bereiteten.
In der Zwischenzeit war, von uns unbemerkt, da wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf die zu rettenden Menschen konzentriert hatten, die „Moltkefels“ von Schleppern an den nahen Strand auf Grund gesetzt worden, sodaß sie nicht sinken konnte. Erst als am späten Nachmittag die Brände auf die an Deck abgestellten Lkws überzugreifen drohten, beendeten wir unsere spektakuläre Rettungsaktion und legten unseren Fährprahm abseits der großen Schiffe vor Anker. Wie viele Menschen allein wir von F 210 vor einem sicheren Tod bewahrt hatten, hat niemand gezählt. Doch wir alle fanden eine tiefe Befriedigung in dem Bewußtsein, in dieser schlimmen Schiffskatastrophe, über die man nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen konnte, solch intensive Hilfe geleistet zu haben.
Auch in den folgenden Tagen befand sich unser Fährprahm im Brennpunkt feindlicher Luftangriffe, sowohl im Kriegshafen von Hela, wo uns fast senkrecht herabstürzende Kampfflugzeuge nur ganz knapp verfehlten, als auch auf unserem Weg zur Weichsel, wo sich in einem Fall, es war abends kurz vor Einbrauch der Dunkelheit, eine in Formation fliegende russische Staffel ausgerechnet uns als Ziel ausgesucht hatte, ihre Bombenlast aber in solcher Höhe ausklinkte, daß es unserem Kommandanten gelang, durch eine scharfe und geschickte Kursänderung den ganz nahen Einschlägen gerade noch zu entgehen. (Bei einem dieser Direktangriffe auf den Kriegshafen von Hela wurde übrigens unser nahe bei uns liegende Schwesterboot F 274 am Heckanker getroffen, wodurch einige Verluste bei der Besatzung entstanden.)
Abgesehen von diesen geschilderten Gefahren entwickelten sich unsere oben geschilderten Transporte allmählich fast zu einer Alltags- bzw. Allnachtsroutine: beginnend mit der Übernahme von Ladungsgut aus Handelsschiffen, dann in der Dunkelheit Fahrt zur Weichselmündung, dort sofortiges Ausladen der Fracht durch bereitstehende Hilfskräfte, anschließend Einschiffen von Flüchtlingen und zu guter Letzt Rückfahrt am frühen Morgen vor Sonnenaufgang. Meist kamen wir erst zur Ruhe und konnten den versäumten Schlaf nachholen, den wir während der Nachtstunden durch Unmengen von starkem Kaffee verdrängt hatten, wenn wir etwas abseits von Hela auf Reede vor Anker gegangen waren.
Aber sehr lange war uns diese Ausspannzeit nicht vergönnt, denn gewöhnlich begann nach wenigen Stunden dieser eben skizzierte Kreislauf von neuem. Zwischendurch konnte es zu unserer Freude schon mal passieren, daß sich die Beladung in der Weichsel aus irgendeinem Grund derart verzögerte oder die mitzunehmenden Flüchtlinge noch nicht bereitstanden, daß wir nicht rechtzeitig auslaufen konnten und den folgenden Tag an Ort und Stelle liegen bleiben mußten. Diese unverhoffte „Freizeit“ benutzten wir dann in erster Linie dazu, unterbliebenen Schlaf nachzuholen und an den Nachmittagen uns die Füße einmal wieder an Land zu vertreten, denn auf andere Weise hatten wir in diesen anstrengenden Wochen keine Möglichkeit, von Bord zu kommen.
Ich selbst unternahm bei solchen Gelegenheiten gerne kleinere Erkundungsausflüge in die nähere Umgebung, um mir wenigstens ein ungefähres Bild von der Landschaft und den vielen noch auf Rettung wartenden Menschen zu verschaffen. Eigenartigerweise, und dies wird mir erst heute, wo ich meine Erinnerungen an die damaligen Aufenthalte in der Weichselniederung zu Papier bringe, so richtig bewußt, haben uns die Russen in diesem Gebiet, im Gegensatz zu ihren ständigen Attacken auf der Reede von Hela, bei Tage fast völlig in Ruhe gelassen. Nur des Nachts machte hin und wieder ein einsames Flugzeug, offenbar ein älteres Modell, die Gegend unsicher und warf ungezielt hier und da eine Bombe kleineren Kalibers ab, ohne großen Schaden anzurichten. Wegen seiner schnurrenden Geräusche wurde diese Maschine allgemein, fast liebevoll, „die Nähmaschine“ genannt, was ein wenig die Geringachtung zum Ausdruck bringt, die wir diesem Objekt gegenüber hatten.
Obgleich, wie aus meiner bisherigen Berichterstattung über die Situation in der Danziger Bucht hervorgeht, sowohl die Versorgung der noch in diesem Gebiet kämpfenden Truppenteile als auch die Rückführung von Flüchtlingen im Prinzip gut organisiert waren und selbst durch hartnäckige russische Luft-, Schnellboots- und Artillerieangriffe nicht ernstlich beeinträchtigt wurden – sieht man einmal bei den dabei entstandenen schmerzlichen Verlusten von vielen Menschenleben ab - kam doch von der zweiten Aprilhälfte an bei der deutschen Marineleitung langsam die Erkenntnis auf, daß diese inzwischen mehrere hundert Kilometer von eigenen Häfen entfernten Brückenköpfe nicht mehr lange gehalten werden konnten.
Selbst unverbesserliche Optimisten mußten einsehen, daß der Krieg demnächst mit der totalen Niederlage Deutschlands enden würde und man der immer noch unbeirrbar das Gegenteil behauptenden Propaganda, die weiterhin über den Rundfunk verbreitet wurde, keinen Glauben mehr schenken durfte. So bereitete man sich vorsorglich auf eine Absetzbewegung nach Westen vor, denn eine Übergabe der noch im Osten operierenden Kriegsschiffe an die Sowjetunion wollte man unter allen Umständen verhindern: Dann noch lieber in britische Gefangenschaft gehen, wo man auf eine humanere Behandlung hoffen durfte. Entsprechend dieser Überlegungen wurden die Kommandanten der zur 9. Sicherungsdivision gehörenden Fahrzeuge angewiesen, regelmäßig ihren Bestand an Treibstoff zu melden und eventuell zu ergänzen, um sicherzustellen, daß er für die Fahrt in einen westlichen Hafen ausreichte.
Wir Besatzungsmitglieder von F 210 – und ich möchte unterstellen, daß dies bei der Mehrzahl anderer Kriegsschiffseinheiten ebenso der Fall war - zogen aus diesem Sachverhalt die naive Schlußfolgerung, daß wir nach Kriegsende und Ankunft in einem von Engländern besetzten Hafen unsere „fahrbaren Untersätze“ übergeben würden und anschließend einfach nach Hause fahren könnten. Aber mit welchem Transportmittel? Rechneten wir doch damit, daß vorläufig kein geregelter Eisenbahnverkehr in Deutschland durchführbar war. Also mußten Fahrräder her, mit denen wir weitgehend unabhängig waren. Diese Drahtesel standen an den Anlegestellen in der Weichselmündung reihenweise herum, da ihre Besitzer, die es bis hierher geschafft hatten, sie nicht mit auf die Schiffe nehmen durften.
Als auch ich mich eines Tages auf der Uferseite von Nickelswalde gerade aufmachte, ein herrenloses herumstehendes Fahrrad auszuwählen, kam mir der Zufall zu Hilfe. Ein Feldwebel, der mit seiner Einheit nach Hela übergesetzt werden sollte, stieg direkt vor unserem Fährprahm von seinem fast neuen Rad ab und antwortete mir auf meine Frage, was er damit mache: „Das Fahrrad können Sie haben, ich brauche es nicht mehr!“ So blieb mir die weitere Suche erspart, ich nahm das Vehikel mit an Bord und befestigte es im Laderaum vorläufig an eine freie Wandstelle, bis ich es später einmal benutzen sollte. Nach einer gewissen Zeit hatte fast jedes Besatzungsmitglied auf ähnliche Weise wie ich für eine geplante spätere Heimfahrt vorgesorgt.
Jetzt hatten wir zwar ein Transportmittel, aber nun mußten wir uns auch um Verpflegung für die Tage der Heimfahrt kümmern. Dies war bei den zahlreichen Provianttouren nicht allzu problematisch. Ein paar Büchsen Fleisch oder einige Packungen Zigaretten weniger in die Versorgungslager fielen bei der Masse der von uns beförderten Güter überhaupt nicht auf, obwohl dies illegal war. Indessen rechneten wir damit, daß sich über kurz oder lang für einige Zeit jede staatliche Ordnung sowieso auflösen würde. In dieser Auffassung wurden wir noch gestärkt, als am 1. Mai die Nachricht über den Äther kam, daß Adolf Hitler, „bis zum letzten Atemzug kämpfend, gefallen ist“.
Indessen fuhren wir vorläufig fast noch Nacht für Nacht unbeirrt unsere Routinestrecke, um möglichst vielen Menschen das Schicksal zu ersparen, unter sowjetische Herrschaft zu gelangen. Im Verlauf dieser Einsätze hat allein unsere 13. Landungsflottille zusammen mit anderen Kleinfahrzeugen nach authentischen Unterlagen, die mir erst jetzt zu Gesicht kamen (siehe Jürgen Rohwer: Chronik des Seekriegs 1939 – 1945), in der Zeit vom 1. – 8. Mai 1945 etwa 150.000 Flüchtlinge und Soldaten von der Weichselniederung zur Halbinsel Hela gebracht, die aber nur noch zum Teil in den sicheren Westen weitertransportiert werden konnten. Dann kam, jedoch nicht ganz überraschend, das Ende im Osten, nachdem bereits drei Tage vorher ein Waffenstillstand mit den Westalliierten abgeschlossen worden war.
Kriegsende an der Weichsel
Am 8. Mai 1945, es war ein herrlicher Frühlingstag mit angenehmen Temperaturen, lag unser Fährprahm F 210 zusammen mit mehreren anderen Booten unserer 13. Landungsflottille am Ostufer der Weichsel nahe bei Nickelswalde und wartete auf nähere Anweisungen zur Übernahme von „Fahrgästen“. Da sickerte unversehens die Nachricht durch, Deutschland habe bedingungslos kapituliert, der Waffenstillstand träte um Mitternacht des gleichen Tages in Kraft.
Was wir schon lange befürchtet hatten, war hierbei fester Bestandteil der Bedingungen: Alle östlich von Bornholm befindlichen deutschen Verbände einschließlich der dort operierenden Marineeinheiten sollten sich der Sowjetunion gegenüber ergeben und ihre Schiffe an sie ausliefern. Die deutsche Marineleitung war indessen nicht gewillt, diesem Ansinnen nachzukommen. Sie konnte zwar nicht offen den Durchbruch nach Westen anordnen, da dies dem Kapitulationsabkommen widersprochen hätte, überließ es jedoch den einzelnen in der östlichen Ostsee befindlichen Einheiten, sich auf eigenes Risiko den Weg in den Westen zu suchen.
Die Führung der 9. Sicherungsdivision hatte, wie vorher schon kurz erwähnt, ihre Entscheidung für diesen Ernstfall rechtzeitig getroffen, indem sie allen ihr unterstellten Flottillen die Anweisung erteilte, für die lange Fahrt genügend Treibstoff vorzuhalten. Dazu kam jetzt noch die Absprache mit den örtlichen Heeresabteilungen, möglichst viele Soldaten mit in den Westen zu nehmen. Anfangs fürchteten wir, daß die Nachricht von der Kapitulation eine heftige Reaktion bei den in der Weichselmündung stationierten Soldaten auslösen und letzten Endes zu einem regelrechten Sturm auf die bereitliegenden Fährprähme führen könnte. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen wurden von den einzelnen Kommandanten getroffen: Überall wurden bewaffnete Wachen an die Bootszugänge postiert, und auch ich steckte meine Pistole für alle Fälle ein.
Aber wieder einmal siegte hier der Sinn der Deutschen für eine geregelte Ordnung. Überdies fanden sich am Ufer vor den Fährprähmen zahlreiche Feldpolizisten ein, in der Umgangssprache „Kettenhunde“ genannt, und sorgten dafür, daß kein Unbefugter an Bord gelangte. Aber vorläufig blieb alles ruhig. Und dann erschienen am Nachmittag in geschlossener Formation diejenigen Truppenteile, die mit in den Westen genommen werden sollten.
Für F 210 war dies die Aufklärungsabteilung 4 aus Wien, bestehend aus etwa dreihundert Mann, unter der Führung eines schnauzbärtigen adligen Majors, der nach wie vor stolz am Hals sein Ritterkreuz mit Eichenlaub trug. Seine schwarzgekleideten Mannschaften waren weitgehend ohne Waffen zu uns gekommen, brachten dafür aber ausreichend Verpflegung für mehrere Tage mit an Bord. Sie richteten sich im Laderaum und auf dem Oberdeck häuslich ein. Für die Offiziere fanden wir noch ein Plätzchen in unseren eigenen Decks. Schließlich nahm unsere Bootsgruppe auf eigene Faust noch die Angehörigen einer leichten Flakbatterie an Bord unter der Bedingung, daß sie ihre 2 cm-Geschütze samt genügend Munition mitbrächten und erstere an geeigneter Stelle der jeweiligen Oberdecks zum Schutz vor eventuellen Fliegerangriffen aufmontierten.
Gegen Abend erschienen am Weichselufer immer mehr deutsche Soldaten in der Hoffnung, eine Mitfahrgelegenheit zu finden. Es tat uns zwar in der Seele weh, diese Männer zurücklassen zu müssen, aber unsere Boote waren bereits voll besetzt. Doch die anfangs von uns befürchtete Panikstimmung war nirgends zu bemerken.
Ungefähr gegen 22 Uhr legten wir ab, fuhren das kurze Stück die Weichsel abwärts und nahmen dann, in die Nacht hineinfahrend, Kurs nach Westen. Schemenhaft sahen wir vor, neben und hinter uns zahlreiche andere Fahrzeuge, vollbeladen mit Menschen, die in die gleiche Richtung wie wir strebten, darunter gab es allerdings manche, deren Seetüchtigkeit wir mit Recht bezweifelten. Ich selbst teilte mir mit dem Kommandanten die jeweils vierstündige Brückenwache. Als jedoch am folgenden Morgen der Wind auffrischte, die Wellen höher wurden und unser Fährprahm allmählich in eine Schaukelbewegung überging, bekamen doch einige unserer Gäste bleiche Gesichter und mußten ihre Abendmahlzeit den Fischen opfern. Gleichwohl behielten die meisten von ihnen ihre gute Stimmung bei angesichts der Gewißheit, einer russischen Gefangenschaft glücklich entkommen zu sein. Allerdings setzte dieser ungemütliche Wellengang einigen der von mir erwähnten weniger seetüchtigen kleinen Fahrzeuge derart zu, daß sie in arge Not gerieten und durch andere in ihrer Nähe befindlichen Schiffe von einem Großteil ihrer Menschenfracht befreit werden mußten.
Als wir gegen Mittag in die Nähe der Insel Bornholm kamen, sahen wir, was wir schon befürchtet hatten, wie sowjetische Schlachtflugzeuge weit vor uns fahrende Fährprähme angriffen, um deren Weiterfahrt in den Westen zu unterbinden, aber bald abdrehten, als ihnen starkes Flakabwehrfeuer entgegenschlug. Denn anscheinend wollten die Piloten dieser Maschinen am Tage nach Wirksamwerden des Waffenstillstandes auch nicht mehr das Risiko eingehen, vielleicht abgeschossen zu werden. In unserer eigenen Gruppe waren natürlich alle Flakbedienungen einsatzbereit, sowohl die eigenen als auch die am Vortag zusätzlich an Bord genommenen. Aber wir alle waren heilfroh, daß sie nicht mehr in Aktion zu treten brauchten und wir unseren Kurs unbehelligt fortsetzen konnten.
Ungefähr zur Mitte des folgenden Tages erreichten wir die Gewässer um die Insel Fehmarn. Nach wie vor flatterte am Mast die Reichskriegsflagge, wie dies von jeher die Vorschrift bei der Kriegsmarine war, wenn man sich auf See befand. Da wurden wir unversehens von einem an unserem Weg vor Anker liegenden deutschen Vorpostenboot, das ein weißes Tuch am Mast gesetzt hatte, angeblinkt und ermahnt, die Flagge herunterzuholen, anderweitig würden wir bei einer Begegnung mit englischen Kriegsschiffen beschossen.
Wie reagierte hierauf unser Kommandant? Er ließ zuerst die augenblicklich am Mast wehende, aber nach längerem Gebrauch bereits stark ausgefranste Flagge gegen ein nagelneues Exemplar austauschen. Dann mußte unsere gesamte Besatzung in Reih und Glied an Deck antreten, unser Major aus Wien befahl seinen eigenen Untergebenen, das Gleiche zu tun, und schließlich ließ unser Kommandant, während alle Soldaten den militärischen Gruß erwiesen, von einem altbewährten Besatzungsmitglied die Flagge langsam einholen, einrollen und machte sie ihm zum Geschenk. Jedoch, ein weißes Tuch zum Zeichen der Kapitulation setzte er nicht.
Nach dieser Zeremonie kam uns unsere totale Niederlage erst so richtig zum Bewußtsein. Einerseits waren wir erleichtert, diese letzten gefährlichen Einsatzwochen heil überstanden zu haben, aber etwas ehrenvoller hatten wir uns das Kriegsende doch vorgestellt. Doch jetzt „entsorgten“ wir erst mal die gerade zwei Tage zuvor installierten und jetzt nicht mehr benötigten Flakgeschütze in die Ostsee und warfen ihnen alle möglichen noch an Bord befindlichen Waffen und Explosionskörper hinterher. Ich selbst entledigte mich auf dem gleichen Wege mit elegantem Schwung meiner nie benutzten Dienstpistole.
Wenige Stunden später erreichten wir die Kieler Außenförde und ankerten in der Strander Bucht, ungefähr dort, wo sich heute das Olympiazentrum befindet. Unsere Hoffnung, sofort unsere Gäste aus der Ostmark an Land setzen zu können, erfüllte sich leider nicht, denn die an den wenigen Anlegestellen postierten englischen Soldaten verweigerten alle derartigen Pläne. So sammelte sich allmählich in dieser Bucht eine ganze Armada verschiedenartigster Schiffstypen, alle voll beladen vorwiegend mit Soldaten, die teilweise sogar von Libau in Lettland aus gestartet waren.
Angesichts dieser Vielzahl von Schiffen wurden die Engländer leicht nervös und fuhren am Strand gepanzerte Fahrzeuge und Scheinwerfer auf, um eventuelle illegale Landungsversuche während der darauffolgenden Nacht zu verhindern. Doch alles blieb ruhig, bis nach Einbruch der Dunkelheit irgend jemand auf einem dieser Schiffe auf die witzige Idee kam, an Bord noch vorhandene Leuchtraketen abzuschießen, die alsbald so zahlreiche Nachahmer fand, daß die ganze Bucht schließlich von einem prächtigen Feuerwerk hell erleuchtet war.
Nach tagelangem Herumliegen und allmählich eintretenden Verpflegungsengpässen erhielten wir endlich die Anweisung, eine kurze Strecke in Richtung Osten, an Fehmarn vorbei, zurückzufahren und in Heiligenhafen unsere an Bord befindlichen Ostmärker an Land zu setzen. Die waren jedoch inzwischen überraschend schnell wieder zu Österreichern mutiert, nachdem sie gemerkt hatten, daß sie mit dieser alten Nationalität eventuell früher nach Hause kämen. Zu ihnen hatten wir aber bis zuletzt ein ausgesprochen gutes und herzliches Verhältnis, denn sie waren uns überaus dankbar, daß wir sie vor einer Gefangennahme durch die Russen bewahrt hatten.
Nach der Ausladung fuhren wir wieder nach Kiel zurück. Jetzt wurden wir in den Tirpitzhafen dirigiert, der im Ortsteil Kiel-Wik angelegt war. Hier sahen wir auch zum ersten Mal, welch große Schäden im gesamten Kieler Hafen durch britische Luftangriffe angerichtet worden waren. Und besonders vorsichtig mußten wir uns an den Wracks der in diesem Bereich selbstversenkten U-Boote, die durch diese Aktion nicht in feindliche Hände geraten sollten, vorbeimanövrieren.
ziviler Lebenslauf v. Karl-Heinz Koppel
| Zeitraum | Aktivität |
| 1931 - 1935 | Volksschule Karlsruhe |
| 1935 - 1943 | Bismarckgymnasium Karlsruhe (Abitur 1.3.43) |
| März - Juni 1943 | Reichsarbeitsdienst |
| 1946 - 1949 | Studium Wirtschaftswissenschaft an der TH Karlsruhe (Abschluß Diplom-Volkswirt) |
| 1949 - 1982 | Einsatz im Finanz- und Rechnungswesen eines Industrieunternehmens in Karlsruhe, zuletzt als Mit-Geschäftsführer |
| 1986 - 1999 | Lehrbeauftragter an der Berufsakademie in Karlsruhe (jetzt Duale Hochschule) |
Am 20. Mai kam für mich das Ende meiner Bordzeit auf F 210. Auf Anordnung der Engländer sollten die Fährprähme zwar für besonders angeordnete Einsätze weiterhin aktiv bleiben, aber nur noch über eine stark reduzierte Mannschaft verfügen. Da ich hierzu nicht gehörte, packte ich also meinen Seesack, verabschiedete mich vorläufig vom Kommandanten und den wenigen übriggebliebenen Besatzungsmitgliedern, mit denen ich in den letzten beiden ereignisreichen Monaten stets ein ausgesprochen gutes Verhältnis hatte, und führte die mit mir „ausgemusterten“ Matrosen in die direkt am Ufer gelegene Marinekaserne. An den darauffolgenden Tagen hatte ich zwar noch mehrmals Gelegenheit für Besuche an Bord, denn ich mußte ja unter anderem noch mein Fahrrad und die für eine eventuelle Heimfahrt reservierte Verpflegung abholen, aber dann wurde F 210 in einen anderen Hafen verlegt und verschwand damit endgültig aus Kiel.
Für mich endete damit zwar offiziell meine fast zweijährige aktive Zeit bei der Kriegsmarine, in welcher ich in erster Linie eine umfassende Ausbildung zum Seeoffizier durchlaufen hatte, aber noch war es zu früh, die Uniform ganz auszuziehen. Und so war ich noch mehrere Monate lang, allerdings für einen ganz anderen Dienstherrn – es war die Royal Navy - und völlig ohne jede Bezahlung, in einem ähnlichen Metier wie bisher tätig. Ich hätte mir indes einen etwas ehrenvolleren Abschied gewünscht, doch zu diesem Zeitpunkt wußte ich noch nicht, ebenso wie fast alle meiner damaligen Kameraden, welch große Schuld die damalige Führung des Deutschen Reiches in diesem von ihr entfachten Weltkrieg auf sich geladen hatte, für die auch wir alle dann von unseren Gegnern bis zu einem bestimmten Grad kollektiv zur Verantwortung gezogen wurden.
Und, auch das wird den bisher gelangten Leser zum Schluß dieser Geschichte vielleicht noch am Rande interessieren: mein von der Weichselmündung her mitgeführtes Fahrrad brachte ich, allerdings per Bahn und einige Zeit später, glücklich nach Hause und bin mit ihm noch viele Jahre, bis ich mir einen motorisierten Untersatz leisten konnte, gefahren.