Dänemark / Ostsee
Als Reaktion auf die Erfolge der dänischen Widerstandsbewegung hat Werner Best, Statthalter der Deutschen, in einem Telegramm an das Auswärtige Amt für Dänemark die "Lösung der Judenfrage" gefordert. Mit Beginn des jüdischen Neujahrs setzt von Seiten der deutschen Besatzungsmacht in Dänemark eine intensive Jagd auf jüdische Mitbürger ein. Doch der Schiffahrtssachverständige der deutschen Botschaft, Georg F. Duckwitz (1904-1973), hinterbringt den Beginn der Aktion, so dass an die 7000 dänischen Juden nach Schweden fliehen können. Dennoch werden bis Ende November noch 481 Juden aufgespürt, eingesperrt und nach Theresienstadt (Tschechoslowakei) ins Konzentrationslager verschleppt. Als erstes Schiff verläßt der dtsch. Frachter Wartheland (ex lett. Arija, 3678 BRT) am 2.10. Kopenhagen mit 202 jüdischen Internieren an Bord.
Aus einer Gedenkschrift des Auswärtiges Amtes für G.F. Duckwitz (1904-1973):
 |
. |
|
Georg Ferdinand Duckwitz
|
. |
Am Mittwoch, den 29.09.2004 jährt sich zum hundertsten Mal der Geburtstag des ehemaligen Staatssekretärs des Auswärtigen Amts Georg Ferdinand Duckwitz (1904-1973). Aus diesem Anlass gibt das Auswärtige Amt eine Gedenkschrift heraus, in der vor allem Duckwitz' Beitrag zur Rettung dänischer Juden im Oktober 1943 gewürdigt wird.Duckwitz hatte als Schifffahrtssachverständiger an der deutschen Botschaft in Kopenhagen im Oktober 1943 vor der drohenden Deportation der dänischen Juden gewarnt und damit die Flucht von über 7.000 Menschen ermöglicht. Er wurde bereits 1971 von der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Jad Vashem als "Gerechter unter den Völkern" ausgezeichnet.
Das Auswärtige Amt hat Duckwitz zuletzt durch eine Gedenktafel gewürdigt, die 1999 in der Botschaft Kopenhagen eingeweiht wurde. Duckwitz' hundertsten Geburtstag nimmt das Auswärtige Amt nun zum Anlass, einen Aufsatz des dänischen Historikers Hans Kirchhoff erstmalig in deutscher Fassung herauszugeben. Kirchhoff konnte als erster Historiker die Tagebücher und Kalender von Duckwitz auswerten. Er beschreibt insbesondere die dramatischen Ereignisse des September und Oktober 1943 und geht auch auf Duckwitz´ Verbindungen zum Widerstand des 20. Juli ein.
In einem Vorwort wird zudem die Rolle gewürdigt, die Duckwitz im
Auswärtigen Dienst der Bundesrepublik spielte. Duckwitz setzte sich
schon in den fünfziger Jahren für eine Aussöhnung mit Polen
ein. Er gilt als einer der Vordenker der Ostpolitik und handelte im Auftrag
Willy Brandts den Warschauer Vertrag von 1970 aus.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. Oktober 2004
Ebenso spricht der dänische Historiker Hans Kirchhoff, Autor der ... Broschüre des Auswärtigen Amts zum Gedenken an Duckwitz, durchaus mehr kritische Punkte an, als in aktuellen [Zeitungs-]Artikeln auftauchen. Der Hauptvorwurf, der schon früh von dänischen Seeleuten vorgebracht wurde, zielt auf die Rolle Duckwitz' in der Zeit bis zur deutschen Invasion in Dänemark im April 1940. Duckwitz soll dänische Handelsschiffe als Ziele für die deutsche Kriegsmarine identifiziert haben und somit indirekt am Tod von über 300 dänischen Seeleuten beteiligt gewesen sein. Dieser Vorwurf ist zur Zeit nicht zu entkräften, da alles bislang zugängliche Quellenmaterial zu Duckwitz' Entlastung nur aus seiner Feder stammt. Die Aussage des Staatssekretärs Klaus Schariot im Vorwort der Broschüre "Es ist nicht anzunehmen, daß die Leistung von Duckwitz im Herbst 1943 jemals in Frage gestellt wird" ist wohl im Sinne Melchiors von dem Wunsch nach einem makellosen deutschen Widerstandskämpfer geprägt. Kirchhoff stellt durchaus Duckwitz in Frage und regt eine Biographie über ihn an. Die Verantwortung und die politische Wandlungsfähigkeit von Entscheidungsträgern im "Dritten Reich" soll damit nicht in Frage gestellt werden. Es geht um eine umfassende Darstellung auf der Grundlage des aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstandes.
Die Flucht der dänischen Juden 1943 nach Schweden / Herbert Pundik. - Husum: 1995. - 141 S., Abb.; Original: Det kan ikke ske i Danmark <dän.>
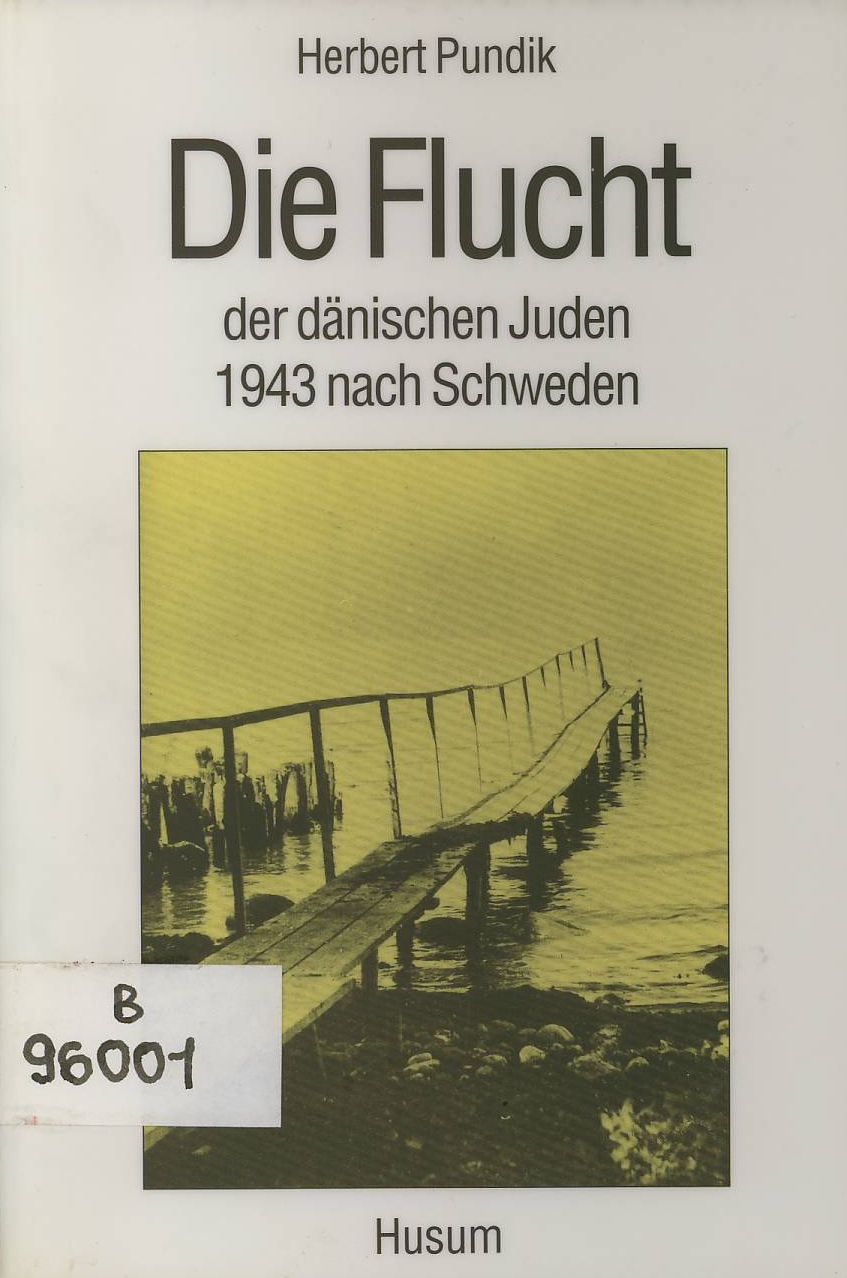 |
Eines der denkwürdigsten und mutigsten Ereignisse des Zweiten Weltkrieges
war die Rettung der rund 7000 dänischen Juden nach Schweden. Herbert
Pundik, dänischer Jude und mehr als 20 Jahre Chefredakteur der auch
international angesehenen Kopenhagener Tageszeitung ,Politiken",
konnte im Oktober 1943 als Schüler mit seiner Familie vor den deutschen
Nazis über den Öresund fliehen. In
seinem 1993 in dänischer Sprache erschienenen Buch "Det kan
ikke ske i Danmark" hat er nicht nur die eigenen dramatischen Erlebnisse
zwischen Leben und Tod geschildert. Jetzt erscheint die deutsche Ausgabe,
geschrieben von einem der bekanntesten dänischen Journalisten, der
als Opfer dennoch den Versuch unternommen hat, die bemerkenswerten Hintergründe
der einmaligen Rettungsaktion auch auf der Täterseite zu beleuchten.
Der deutsche Botschafter in Dänemark, Hermann Gründel, hat
Pundik als einen besonders fairen Kommentator gegenüber dem neuen
Deutschland bezeichnet und als Persönlichkeit gewürdigt, die
einen wichtigen Beitrag zur Verständigung zwischen Deutschen und
Juden geleistet hat. Der Botschafter äußerte die Hoffnung,
dass Pundiks Buch in deutscher Sprache Aufmerksamkeit finden und das Bewusstsein
in Deutschland gegenüber der Vergangenheit stärken möge
- als besondere Verpflichtung in der Gegenwart.
Herbert Pundik schließt sein Buch mit einem moralischen Appell unter Hinweis auf jene Worte ab, die der Schiffahrtssachverständige an der deutschen Gesandtschaft in Kopenhagen, Georg Ferdinand Duckwitz, 1943 in sein Tagebuch schrieb, als er die Juden in Dänemark rechtzeitig warnte: "Ich weiß, was ich zu tun habe." Ein Appell, der an Aktualität auch im Jahre 1995 nichts eingebüßt hat.
Siegfried Matiok, Chefredakteur,NORDSCHLESWIGER"
Deutsche Tageszeitung in Dänemark